Die digitale Radiologie – Vom Röntgenfilm zum Case Viewer
In der medizinischen Ausbildung werden bildgebende Verfahren an verschiedenen Stellen in der Lehre eingebunden, doch man benötigt für den sicheren Umgang eine gewisse Routine. Daher entwickelt Dr. Kay-Geert Hermann eine Anwendung, die Medizinstudierende, aber auch Ärztinnen und Ärzte, Fall für Fall durch die Bildgebung führt. Für sein Engagement im Bereich e-Learning wird er als Clinical Fellow von der Stiftung Charité gefördert. Wir trafen ihn, um mehr über den gegenwärtigen Stand der Entwicklung und die Idee hinter der Anwendung zu erfahren.
Herr Dr. Hermann, wie sah die Radiologie zum Anfang Ihrer eigenen Ausbildung aus?
Als ich vor 20 Jahren in der Radiologie anfing, gab es noch Röntgenfilme und Entwicklungsautomaten. Derjenige, der das Original in der Hand hatte, konnte es anschauen. Wenn man es auf der Station brauchte, musste man es dafür abholen. Dann konnte es sich der Radiologe nicht mehr anschauen. Heute verteilt sich das Bild binnen Sekunden in unzähligen Kopien. Natürlich wurde schon mit der Computertomografie gearbeitet, aber auch diese Bilder wurden nicht elektronisch auf die Stationen verteilt, sondern auf Filmen ausgedruckt. Es gab riesige Maschinen, in die man diese Bilder einhängen konnte und die sie dann sortiert haben. Das gibt es heute alles nicht mehr.
Sie entwickelten in den 1990ern im Rahmen Ihrer Doktorarbeit eine CD-ROM. Hatten Sie in Ihrer eigenen Ausbildung als Arzt das Gefühl, dass die Bildgebung zu kurz kam?
Meine klinische Ausbildung war sehr gut. In internistischen Seminaren oder auf der Rheumatologie gab es stets gute Ärzte, die einem das beigebracht haben. Da mich aber das Medium Computer sehr faszinierte, wollte ich dieses Hobby in mein Studium integrieren. Bis dahin gab es ein paar herausragende CD-ROMS, häufig aus Amerika, die man in der Bibliothek ausleihen musste. Das war relativ kompliziert. Zu der Zeit war das Internet noch nicht überall verfügbar und selbst einfache Arbeiten mit Medien auf dem Computer waren schwierig, beispielsweise das Einfügen von Bildern oder Videos in Texten. Ich begann also, an einem Multimediaprojekt zu arbeiten, das dann zu meiner Doktorarbeit wurde und schließlich als CD-ROM veröffentlicht wurde.
War es als technikaffiner Mediziner naheliegend, in die Radiologie zu gehen?
Eigentlich musste ich mich zwischen der Rheumatologie und meinem Interesse an technischen Entwicklungen entscheiden. Im Praktischen Jahr fand ich allerdings Gefallen an der Radiologie, wo ein großer Bedarf an Bildgebung für die Gelenke bestand. Also spezialisierte ich mich in diese Richtung und veröffentlichte insbesondere über Arthritis einige Studien, um dem Ziel der Habilitation näher zu kommen.
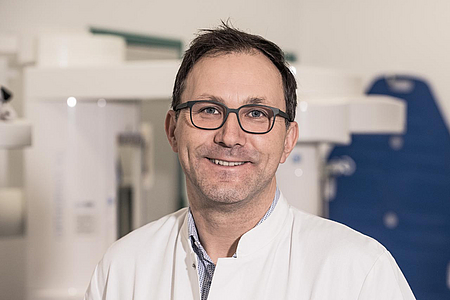
Förderprogramm
BIH Clinical Fellows
Förderzeitraum
2017 bis 2019
Vorhaben
Charité Case Viewer
Fachgebiet
Radiologie
Institution
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Seit 2005
Arbeitsgruppenleiter „Arthritis Imaging Research Group, Klinik für Radiologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Seit 2007
Oberarzt an der Klinik für Radiologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin
2010
Habilitation im Fach „Diagnostische Radiologie“
Die messbare Einheit in der wissenschaftlichen Karriere sind Publikationen. Wenn man neue Techniken für die Lehre entwickelt, ist das zwar wichtig für die einzelne Universität, aber nicht geeignet, um darüber eine wissenschaftliche Abhandlung zu schreiben. Also verfolgte ich mein Interesse an der elektronischen Lehre in meiner Freizeit weiter. Irgendwann kam mir die Idee, dass der Bedarf auch außerhalb der studentischen Ausbildung enorm ist. Radiologen kennen sich mit der Bildgebung aus, doch die Abnehmer für die Bilder und Berichte, also alle anderen Ärzte, müssen es auch verstehen. Wir haben dann in der Rheumatologie Schulungen organisiert, wie man Röntgen, MRT und CT interpretiert. Dafür haben wir eine Software für iPads entwickelt.
Das war dann der Berlin Case Viewer? Was ist an Ihrem neuen Projekt nun anders?
Der Berlin Case Viewer war ein Hilfsmittel für Schulungen, das außerhalb der Charité in Privatinitiative mehrerer Experten entwickelt wurde. Daraufhin hatte ich die Idee, das Konzept auch an der Charité zu implementieren und für Studierende verfügbar zu machen. Das soll mit dem Charité Case Viewer geschehen, für den ich die Förderung der Stiftung Charité erhielt. Dieses Mal soll das Programm in einem ganz normalen Webbrowser laufen.
Wurden die Studierenden, die ja quasi die Endnutzer sein werden, auch in die Entwicklung eingebunden?
Ich habe den Berlin Case Viewer den Studierenden in meinen Seminaren gezeigt. Vor allem in der Anatomie, wo man eigentlich am Seziertisch arbeitet, kam die Zusammenarbeit von Anatom und Radiologe sehr gut an. Ich konnte jeweils am Bild zeigen, was der Anatom gleichzeitig im Präparat darstellte.
Das ergab einen wahnsinnig großen Lerneffekt. Viele Studierende haben mich gefragt, wie man an diese App kommt. Leider musste ich sie bisher immer enttäuschen, da die App nicht öffentlich zugänglich war. In meiner Forschungszeit als Clinical Fellow konnte ich nun die Idee weiterentwickeln.
Wo stehen Sie momentan in der Entwicklung des Charité Case Viewers?
Es war kompliziert, die App so umzugestalten, dass sie auch im Webbrowser läuft. Die meisten Funktionen kann man viel besser in einer App programmieren, daher mussten sie simplifiziert werden. Ich koordiniere und steuere das Projekt, an dem zwei Programmierer und ein Designer arbeiten. Mittlerweile ist das Web-Tool prinzipiell lauffähig und soll an andere Systeme in der Charité angeschlossen werden. Momentan versuche ich daher, eine geeignete Lösung für den Datenschutz zu finden. Als erstes Anwendungsszenario pflegen wird die Daten eines Kollegen ein, der als Experte für Nieren- und Milzerkrankungen extrem seltene Fälle gesammelt hat. Das ist das erste Modul und sollte ab dem Sommer verfügbar sein.
Um die Datenbanken der unterschiedlichen Bereiche an der Charité zu integrieren, muss man sicherlich gut vernetzt sein. Wie lange braucht man bei einem Krankenhaus, das quasi ein gesamtes Dorf ist, um einen guten Überblick zu haben?
Meine Erfahrung an der Charité lief so ähnlich ab wie mein Einleben in Berlin: Als ich neu nach Berlin kam, wollte ich im ersten Jahr dringend wieder weg. Berlin war unfreundlich, es war kalt, trübe und grau. Ich war von dieser riesigen Stadt schockiert, von der Anonymität. Die Busfahrer fuhren weiter, obwohl man gerade zum Bus rannte. Im zweiten Jahr wurde es aber etwas besser und im zehnten Jahr fand ich es hier richtig geil. Die Charité ist eine historisch bedeutsame Einrichtung, das verleiht einem ein gewisses Gefühl, wenn man hier studiert oder arbeitet. Dennoch versteht man die Funktionsweise der Charité nicht sofort und braucht einige Jahre, um die Abläufe wirklich zu durchschauen. Je nachdem, in welcher akademischen Phase man sich gerade befindet, gibt es verschiedene Facetten der akademischen Landschaft, die man kennenlernen muss. Das ist immer wieder ein neuer Entdeckungsgang und es gibt keinen allgemeingültigen Weg. Aber ist es schön, zu sehen, wie viele verschiedene Karrierewege hier letztendlich zusammenkommen.
Januar 2019 / MM
